Postmoderner Liberalismus
gefährliche Chimäre oder attraktive Alternative?
Buchbesprechung zu Mark Pennington (2025): Foucault and Liberal Political Economy: Power, Knowledge, and Freedom, OUP.
Otto Lehto
Mark Penningtons neues Buch ist Provokation, Aufruf zum Handeln und Weckruf zugleich. In Foucault and Liberal Political Economy zeichnet er die Zukunft des Liberalismus in einer Verbindung von F.A. Hayek und Michel Foucault und zeigt auf, wie wir Freiheit, Macht und Institutionen neu denken sollten. Man kann es schwer aus der Hand legen, so aktuell, gut recherchiert und überzeugend ist es. Noch weniger lässt es sich ignorieren. Die Lektüre lohnt sich selbst für jene Liberale, die dem „Postmodernismus” skeptisch gegenüberstehen.
Ich muss zunächst ganz offen gestehen, dass ich schon habituell eine gewisse Schwäche für Penningtons Vision habe. Um morgens aus dem Bett zu springen, brauche ich, statt einen doppelten Espresso zu trinken, nur Hayek lesen. Gleichzeitig gibt es für mich nichts Langweiligeres als intellektuelle Konformität. Wenn ich merke, dass um mich herum niemand anderer Meinung ist, will ich nichts als weg. Ich finde also, es braucht gerade solche ungewohnten, fast „unheiligen” Gegenüberstellungen wie die von Foucault und Hayek. Schon länger hatte ich das Gefühl, dass Liberale, die von Hayek inspiriert sind, Foucault missverstehen und unterschätzen. Penningtons Buch greift meine Vorahnung auf, dass man ganz einfach sowohl Hayek als auch Foucault lieben kann, so wie ein Metalhead die Feinheiten des Bebop-Jazz oder des Berliner Minimal Techno schätzen mag.
Manchen sind ein fabrikneuer Ferrari oder eine Gucci-Tasche Zeichen des Erfolgs. Als guter Akademiker misst man Erfolg natürlich daran, wie oft die eigenen Texte zitiert werden. Und nach dieser Metrik hat Foucault das meiste Bling-Bling der Branche. His numbers are insane. Big, big numbers.
Vier Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahr 1984 steht Foucault weiterhin an der Spitze der meistzitierten Autoren in den Sozialwissenschaften, übertroffen nur noch von Karl Marx selbst – dessen Ideen, wir erinnern uns, die halbe Welt erobert haben! Foucault sah mit seinem prächtig-kahlen Kopf, der stilvollen Kleidung und seiner Brille wie ein klassischer französischer Intellektueller aus. Als Pop-Intellektueller fuhr er mit seinem Jaguar durch Europa oder nahm LSD im Death Valley, während er mit Freunden aus Kalifornien Karlheinz Stockhausen hörte (was, um ehrlich zu sein, wie ein wunderschöner Albtraum klingt). Sein typisches Wochenende verbrachte er in BDSM-Clubs auf der Suche nach Grenzerfahrungen.
Studenten auf der ganzen Welt kennen Foucault als diesen etwas eigenartigen französischen Philosophen, der argumentierte, dass Gefängnisse, Krankenhäuser und Schulen einer ähnlichen Macht-Logik folgten. Für Konservative dagegen ist er ein ideologischer Terrorist, ein bösartiger Krebs, der die westliche Zivilisation zerfrisst. Und für angehende Radikale ist sein glänzender, kahler Kopf zu einer kulturellen Ikone geworden, zu einem unwahrscheinlichen Sexsymbol für gefährliche Ideen, denen ein besonderer Reiz innewohnt. Aber was genau sind seine gefährlichen Ideen? Ist die französische „Theorie”, insbesondere die viel beschworene „Postmoderne” (deren Opa Foucault ist), nicht einfach nur „fashionable nonsense”, wie es im Titel eines einflussreichen Buches von Alan Sokal und Jean Bricmont aus dem Jahr 1997 heißt?
Eine zentrale Erkenntnis aus Penningtons Buch ist: Foucault und Hayek sind ganz und gar nicht unwahrscheinliche Bettgenossen, sondern teilen dieselbe Grundidee. Beide glauben, dass wir in einer komplexen Welt leben, die am besten bottom-up und nicht top-down regiert werden sollte. Politiker denken, dass sie die Welt regieren – kulturelle Eliten denken das auch. Aber sie irren sich alle. Niemand hat die Kontrolle – weder Elon Musk, noch deine Großmutter, und sicher nicht der Instagram-Influencer, der für Klicks sogar Pferdepenis isst. Stattdessen sind Macht und Wissen immer dezentralisiert und verteilt. Sie befinden sich in menschlichen Netzwerken, die sich aus Millionen von Individuen, Institutionen und kulturellen Praktiken bilden und reproduzieren. Du und deine Freunde werden nicht nur passiv „beeinflusst“, geschweige denn „unterdrückt“, sondern nehmen immer aktiv an verschiedenen „Spielen“ der Macht teil. Aus der gleichen Idee heraus, so Pennington, habe Hayek gezeigt, dass die Marktwirtschaft deshalb so brillant ist, weil sie verteiltes Wissen durch Preissignale koordiniert. Aus diesem dezentralisierten Prozess entstehe eine „spontane Ordnung”.
All diese Strukturen bedeuten nicht, dass Freiheit nur eine Illusion ist. Obwohl wir in einer Welt von Regeln und Normen gefangen sind, die wir nicht geschaffen haben, haben wir dennoch die Macht, zu experimentieren, innovativ zu sein und uns neu zu erfinden. Pennington erklärt: „Subjekte sind immer das Produkt verschiedener Machttechnologien. Freiheit wird nicht durch die Abschaffung solcher Technologien erreicht, sondern indem sichergestellt wird, dass diese nicht erstarren, sondern offen für Herausforderungen und Anfechtungen bleiben, sodass die Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst neu zu erschaffen.” In Anlehnung an Joseph Schumpeter spricht sich Pennington für eine wirtschaftliche und kulturelle „kreative Zerstörung” aus.
Der postmoderne Liberalismus lehnt alle festen oder privilegierten Identitäten ab, sei es Klasse, Rasse, Geschlecht oder Nation, und befürwortet stattdessen eine Kultur im ständigen Wandel – eine hochdynamische Vision, die fast allen aktuellen politischen Strömungen, linken wie rechten, entgegensteht. Hayek war der Ansicht, dass ein gewisses Maß an Konservativismus in Bezug auf Regeln und Normen notwendig sei, eine Lektion, die er von Edmund Burke, dem Begründer des britischen Konservatismus, gelernt hatte. Penningtons Version des postmodernen Liberalismus geht weiter als Hayek, indem sie den dynamischen sozialen Wandel begrüßt. Ob liberale Rechte des Einzelnen gegen die unaufhörliche „kulturelle kreative Zerstörung” Bestand haben können, bleibt jedoch ein Rätsel.
Hayekianer und Foucaultianer sind beide vielgeschmähte und missverstandene Gruppen, die sich selten überschneiden. Beide haben ihre Auswahl wirklich großartiger Ideen. In liberalen Kreisen wird Foucault in der Regel vernachlässigt oder ist – man müsste fast sagen – verboten. Die meisten Menschen hören Foucault aus den Erzählungen Dritter. Vielleicht hören sie einem Jordan Peterson zu, der ihnen mit Tränen in den Augen erzählt, dass Foucault der Teufel ist, passend zur konservativen „Anti-Woke”-Erzählung. Dann neigen sie dazu, Foucault mit linksgerichteter Politik und, Gott bewahre, „kulturellem Marxismus” in Verbindung zu bringen. Sie machen Foucault dann für den Aufstieg der Identitätspolitik verantwortlich – ein Begriff, der alles und nichts heißt –, obwohl seine tatsächlichen Ansichten zu Geschlecht und Sexualität recht individualistisch und liberal waren.
Wie Pennington betont, sind Foucaults Ideen ein gesundes Gegenmittel gegen die ständige Überwachung starrer Identitäten – in ihrer „woken“ wie auch in ihrer „konservativen“ Fassung. Foucault war sicherlich insofern progressiv, als dass er ein Fan kultureller Experimente und Selbstgestaltung war, aber er hätte die moderne „Cancel Culture“ vermutlich als völlig peinlich empfunden. Leider scheint eine Annäherung auch aus der anderen Richtung schwierig zu sein, da akademische Foucaultianer ausnahmslos der Linken angehören und unter einer unheilbaren Allergie gegen Neoliberalismus leiden. Ganz im Gegensatz zu Foucault selbst, der in seinen posthum veröffentlichten Vorlesungen am College de France eine wohlwollende, wenn auch gelegentlich kritische Lesart des Neoliberalismus vorlegte.
Pennington macht deutlich, dass seine Argumentation für den postmodernen Liberalismus unabhängig von der heute aktiv diskutierten Frage ist, ob Foucaults Spätwerk selbst dem Neoliberalismus wohlwollend gegenüberstand. Das ist sicher richtig. Nichtsdestotrotz sah Foucault in seinen „Biopolitik”-Vorlesungen den (Neo-)Liberalismus zumindest als ein vielversprechendes Paradigma, das das Regime der „Disziplin und Bestrafung” zugunsten eines Paradigmas ablehnte, das toleranter gegenüber abweichenden Praktiken und lokalen Experimenten war. Um nur ein Beispiel zu nennen: Foucault beschrieb das Chigaoer Modell der negativen Einkommensteuer (eine Art Bedingungsloses Grundeinkommen) wohlwollend als Mittel zur Beseitigung der Überwachung, sozialen Kontrolle und Bevormundung durch die sozialistisch anmutenden “disziplinierenden” Wohlfahrtsstaaten.
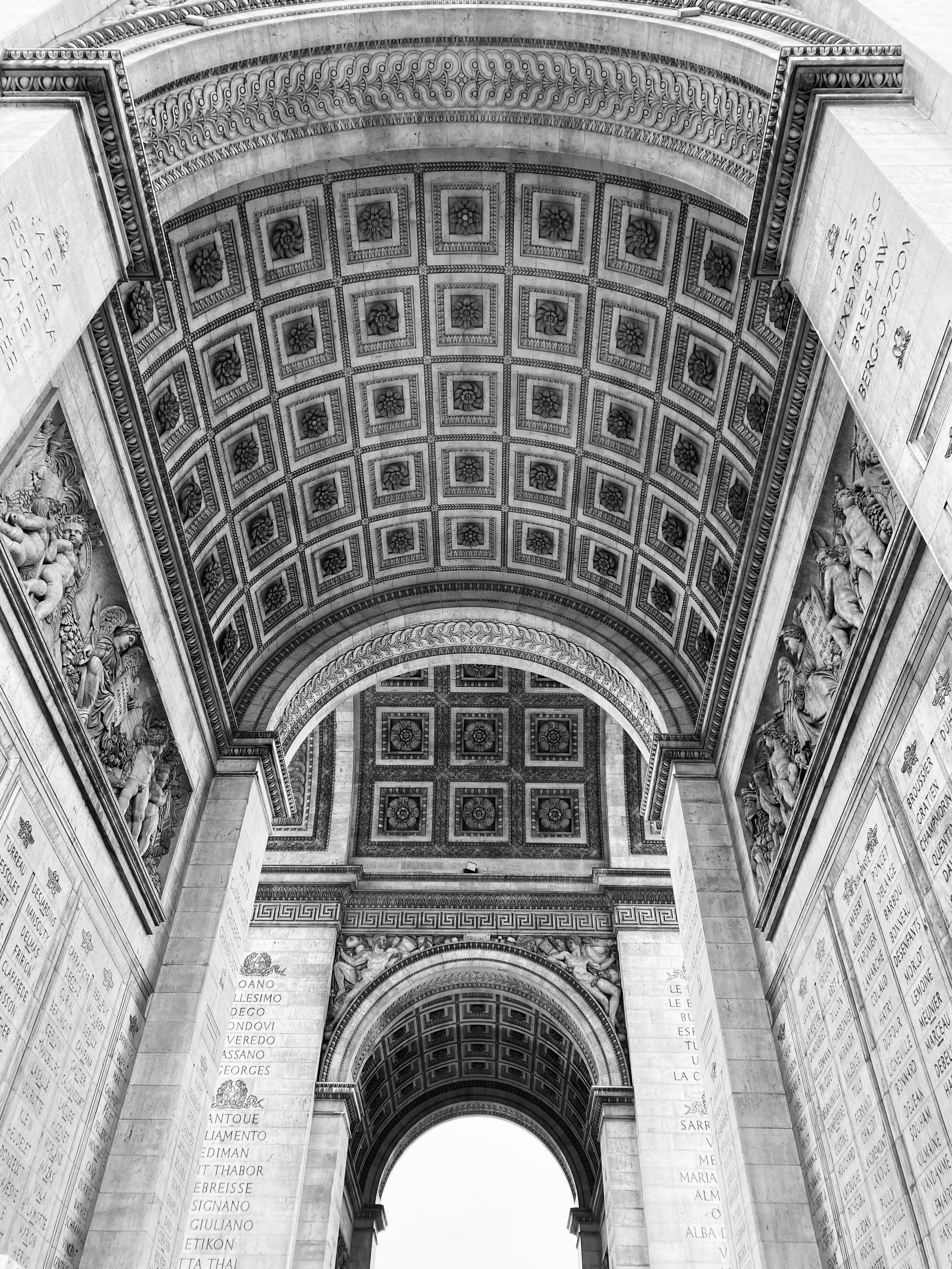
Pennington weitet diese Kritik in spannender Weise auf die Theorien der „positiven Rechte“ in der zeitgenössischen politischen Philosophie aus. Positive Rechte sind Rechte, die den Menschen Rechte auf etwas versprechen (wie Ressourcen, Positionen oder soziale Anerkennung), im Gegensatz zu Abwehrrechten gegen etwas (wie Diebstahl und Mord). Er argumentiert in Anlehnung an Hayek, dass „ein Regime, das sich weitgehend auf den Schutz negativer Rechte konzentriert, sowohl Minderheiten als auch Mehrheiten mehr Spielraum gibt, ihre Werte und Normen zu praktizieren.” Obwohl er die meisten positiven Rechte als hoffnungslose Fälle ablehnt, räumt Pennington dennoch ein, dass es Raum für „zumindest einige positive Sozialleistungen“ geben könnte, darunter ein garantiertes Mindesteinkommen im Stil von Hayek oder der Chicagoer Schule. Auch in diesem Punkt stimme ich ihm zu.
Gegen Ende des Buches greift Pennington einige zeitgenössische Fragen der Politik (einiger„Dispositifs“ im Fachjargon) heraus: soziale Gerechtigkeit, öffentliche Gesundheit, Nachhaltigkeit sowie Fragen der öffentlichen Sicherheit. In jedem Fall zeigt Pennington akribisch, wie die Ausweitung verschiedener „Anliegen“ – wie beispielsweise die Rettung der Erde vor einer ökologischen Katastrophe – den Regierungen neue Befugnisse verliehen hat, die „Bedrohungen der Freiheit durch biopolitische Diskurse hervorrufen, die die Staatsmacht mit dezentraleren Formen der Macht in Einklang bringen und die Individuen und Bevölkerungen als durchschaubare und kontrollierbare Objekte betrachten.“ Die Lektüre dieser Abschnitte kann deprimierend sein, da sie zeigen, wie „nette” Menschen leicht zu den schlimmsten Architekten der Unterdrückung werden können. Wie sind wir vom Kompostieren und Recyceln zu einem „Öko-Degrowth-Autoritarismus” abgedriftet? Mission creep, I guess.
Penningtons Buch ist eine großartige Studie, die zwei starke Sichtweisen auf neue und spannende Weise verbindet. Einige seiner radikalen Implikationen – etwa dass es keine stabile menschliche Natur gäbe, dass sich Kultur frei entwickeln solle und dass wissenschaftliche Expertise nicht mit Politik vermischt werden darf – mögen schwer verdaulich sein. Aber seine grundlegende Argumentation ist überzeugend und inspirierend. So bietet er uns eine neue radikale Vision des Liberalismus, die angesichts der gegenwärtigen Weltlage ein großes Publikum verdient. Ich kann also jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen und sich selbst eine Meinung zu bilden.
Otto Lehto ist Post-Doc am Classical Liberal Institute der New York University.
Er hat zahlreiche Beiträge verfasst zu Themen wie Liberalismus, politische Philosophie, soziale Evolution, Komplexitätstheorie, Innovation, bedingungsloses Grundeinkommen und KI.
Seine Arbeiten wurden unter anderem im Journal of Moral Philosophy, im European Economic Review und in Public Choice veröffentlicht. Promoviert hat er 2022 am King's College London.



