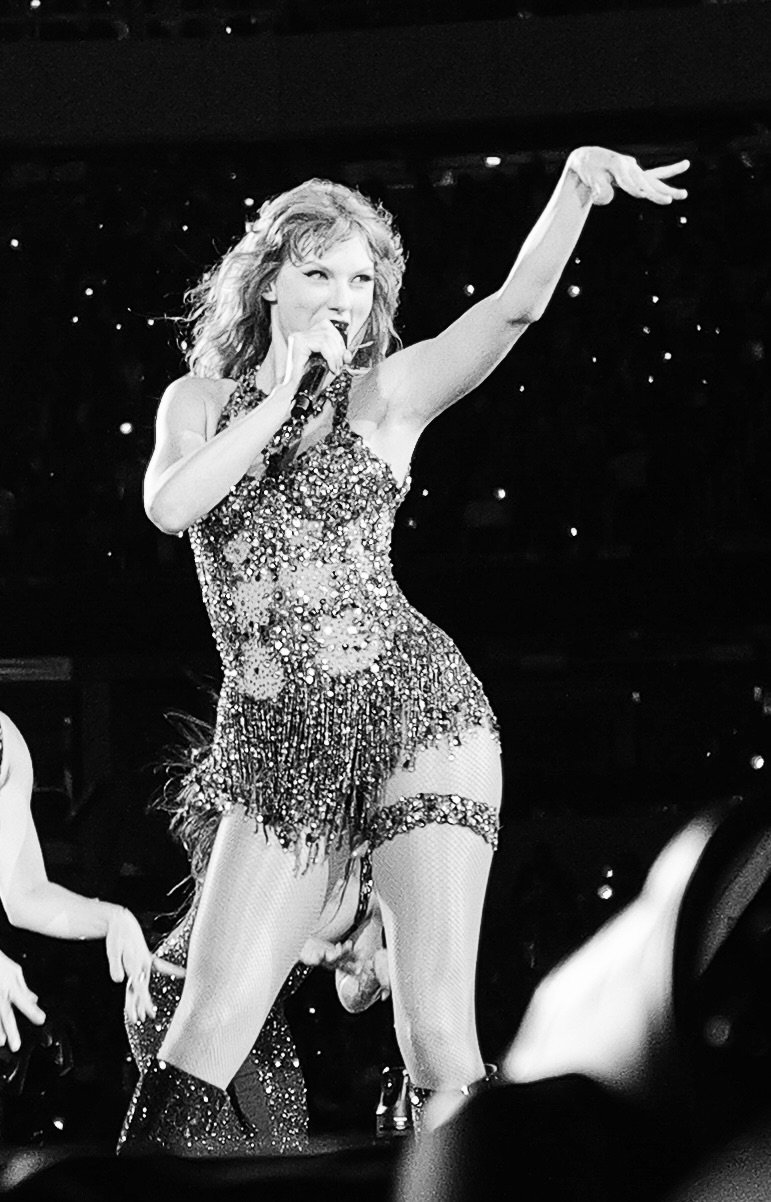Wider den Slop-liberalismus
Der Liberalismus hat das Reden über sich selbst nicht verlernt, nur das Denken. Kaum ein politisches Lager ruft so oft nach Erneuerung. Die einstige intellektuelle Selbstgewissheit des liberalen Lagers ist im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts einer melancholischen Müdigkeit gewichen. Zunehmend nostalgisch im Gestus und leer im Gehalt. Dennoch grassiert ein semantischer Aktivismus: Man müsse den Liberalismus neu denken, neu gründen, neu aufstellen. Neu, neu, neu – ein Mantra, das sich umso häufiger wiederholt, je weniger klar ist, was es eigentlich bedeuten soll.
Alexander Schwitteck
29.10.2025
Taylor Swift – The Eras Tour Midnights Era Set, photo by Paolo V - , CC BY 2.0, edited in bw
Das Neue beginnt selten mit einem Beschluss. Es findet sich nicht in Programmen, Leitartikeln oder starken Sätzen in Reden, sondern in der Unmöglichkeit, so weiterzudenken wie bisher. Wer wirklich neu denkt, denkt gegen sich selbst. Er riskiert und provoziert den Vorwurf, den Boden der salonfähigen Sprachspiele zu verlassen. Schwierig daran ist es, den Mut aufzubringen für Diskontinuität.
Echte Erneuerung ist unbequem und vielleicht letztlich auch unerwünscht. Sie ist eine Zumutung, denn sie verlangt, Gewissheiten zu hinterfragen, eingefahrene Unterscheidungen zu destabilisieren, Denkstile aufzubrechen und die eigenen Doxa – die festgefahrenen Annahmen – zu hinterfragen. Es ist eine Praxis, die dazu drängt, sich selbst fremd zu werden – und deshalb so selten gelingt. Hans-Georg Gadamer bemerkte einmal, dass es die große Schwäche des Computers sei, dass er nicht vergessen könne. Vielleicht ist dies gerade auch die Schwäche der Liberalen. Zu sehr sind wir in den Beschwörungsformeln, Sprachspielen und Argumentationsmustern der eigenen Tradition gefangen.
Trotzdem kündigen Texte oft vollmundig Erneuerung an. Sie beginnen teilweise in der Analyse vielversprechend und lenken dann doch wieder auf die sicheren und tradierten Gleise des Altbekannten ein. Die Strecke ist vertraut, jede Kurve vorhersehbar. Abweichungen? Fehlanzeige. Überraschungen bleiben aus. Es ist ein Denken mit Geländern, gegen das Hannah Arendt Zeit ihres Lebens angeschrieben hat.
Für diese hier kritisierte Textsorte hat sich längst ein eigenes Genre der „liberalen Demokratierettung“ etabliert, das auf dem Buchmarkt regelmäßig beachtliche Erfolge feiert. Das Muster ist stets ähnlich: Zunächst werden soziologische Gegenwartsdiagnosen aufgetürmt, oftmals detailreich und empiriegesättigt. Doch im letzten Drittel tritt unvermeidlich die Wendung ein: Aus der Komplexität des zuvor entfalteten Problemgeflechts wird in erstaunlicher Leichtigkeit ein Katalog von Lösungen proklamiert. Hier noch eine kleine Veränderung des Lebensstils, dort eine neue demokratische Institution – und schon scheint die Krise lösbar. Gerade darin liegt die eigentliche Enttäuschung. Wo die Analyse Schärfe besitzt, stumpft die Therapie ab. Die Spannung, die sich im Text aufgebaut hat, wird nicht eingelöst, sondern entladen in Formeln, die zu oft das Gegenteil von Innovation sind: beruhigend, entschärfend, anschlussfähig.
Es stellt sich etwas ein, was ich als Slop-Liberalismus bezeichnen will. Lange bevor wir mit KI-Slop-Bildern, Videos, Texten und Musik geflutet worden sind, existierte bereits ein Slop-Liberalismus. Dieser bedient sich dem gängigen Sound, greift eklektisch auf bekannte Formeln und Muster zurück. Bei der Lektüre denkt man: nicht schlecht genug, um zu stören, aber auch nicht gut genug, um darüber zu diskutieren. Man quittiert sie mit einem Achselzucken. Die gängige Referenz der großen Klassiker wirkt nur, indem man sich ihrem Verdienst der Vergangenheit andient. Ihre Namen – Kant, Mill, Rawls – werden auf die Texte wie Gütesiegel gepresst, als ob ihre bloße Nennung schon Tiefe erzeugen würde. Es ist die akademische Variante des Easter Eggs.
Dieser Slop-Liberalismus steht sinnbildlich für eine Art liberalen Populismus, der nur noch Haltungen simuliert und sich an Referenzen abarbeitet. Slop-Liberalismus ist weich und bequem. Wie das neue Taylor Swift Album ein Ensemble an Popreferenzen ohne eigene Identität. Er hat keine Ecken, keine Kanten, keine Reibung. Er funktioniert, weil er nicht wehtut. Er ist so stark auf die Gegenwart geeicht, dass er algorithmusoptimiert beliebig wird.
Man denke hierbei zudem an die unzähligen Werke, die Demokratie als eine Frage des richtigen Mindsets behandeln: mehr Dialog, mehr Empathie, mehr „Resilienz“. Der Slop-Liberalismus fließt hier in seiner reinsten Form. Er vermag den Rahmen seiner Krise gar nicht zu verstehen. Der Autor tritt als Coach der Zivilgesellschaft auf, der mit milder Stimme und heiterem Optimismus erklärt, dass alles gar nicht so schlimm sei, solange wir nur „unsere Werte leben“ und wieder miteinander ins Gespräch kommen und wir Demokraten zusammenstehen.

Das Neue verlangt jedoch nicht nur ein verändertes Selbstverhältnis, sondern auch eine neue Denkweise. Die tiefen, oft latenten Strukturen unserer politischen Ontologie – Metaphern, Narrative, Unterscheidungen –, mit denen wir die Welt deuten, prägen unser Denken bereits vor jeder bewussten Reflexion. Unsere liberale Architektur ist jedoch strukturkonservativ geworden: Sie schützt sich selbst und immunisiert sich gegen Veränderung und kritische Befragung. Vielleicht erklärt dies, warum Erneuerungsrufe so oft im Stillstand enden.
Hinter vielen liberalen Appellen zur Erneuerung steht zudem häufig ein nostalgischer Blick zurück. Noch immer wirkt die mächtige Idee nach, dass wir bereits am „Ende der Geschichte“ angekommen seien – an jenem vermeintlichen Zielpunkt, an dem sich Menschenrechte, liberale Demokratie und marktwirtschaftlicher Wohlstand global durchgesetzt hätten. Diese Referenz, so slopesk sie auch in jedem zweiten Essay zur Krise des Liberalismus auftaucht, enthält dennoch einen wichtigen Punkt. Zwar ist man einstimmig in der empirischen Ablehnung Fukuyamas These, doch von ihrem normativen Gehalt löst man sich nicht. Infantil ist das Festhalten daran, weil es den Gedanken ausschließt, dass der Liberalismus selbst Verantwortung für die gegenwärtige Krise trägt. Man hatte ja bereits gewonnen. Und wer gewonnen hat, muss sich nicht mehr verunsichern lassen.
Diese Siegestrunkenheit hat jedoch blind gemacht für die gesellschaftlichen Entwicklungen, die dieses liberale Ensemble anachronistisch werden ließen. Insbesondere dort, wo das liberale Versprechen von gleicher Freiheit nur noch eine Phrase ist, die angesichts der gesellschaftlichen Realitäten selbst diejenigen, die sie im Munde führen, nicht mehr glauben können. Für die Nachgeborenen, die die Periode des kurzen Endes der Geschichte nur aus Erzählungen der Zeitgenossen oder Büchern kennen, wirkt die idealisierte Darstellung der „Welt von Gestern” (Stefan Zweig) fast surreal. Es genügt jedoch nicht, ein System zu verteidigen, das sich selbst zum Finale erklärt hat. Die Frage darf nicht mehr sein, wie man zum Status quo ante zurückkehrt, sondern wie man politische Antworten formuliert, die dem radikal veränderten Zustand der Welt gerecht werden.
Es geht dabei nicht darum, die Geschichte abzuschneiden. Es gibt keinen externen Nullpunkt, von dem aus sich ein neuer Liberalismus stricken ließe, so als wäre man nie Teil jener Erzählung gewesen, die einen nun fesselt. Liberalismus neu zu denken hieße dann nicht, einen neuen Kanon zu schreiben, sondern den alten mit radikaler Ehrlichkeit zu befragen. Begriffe und Ideen unter Quarantäne zu stellen und ins Risiko der begrifflichen Obdachlosigkeit zu gehen, ohne die Wärme des vertrauten Vokabulars und des gewohnten Einrastens der Argumentationsketten.
Vielleicht entdecken wir dabei, dass so manche Wurzeln der Tradition morsch geworden sind. Vielleicht sehen wir, dass wir nicht so liberal sind, wie wir glauben. Und vielleicht ist genau das der Anfang: nicht länger wie bisher zu denken. Wer den Liberalismus neu denken will, muss ihn womöglich zuerst vergessen. Damit er wieder das werden kann, was er einmal versprach: ein Projekt der gleichen Freiheit. Nicht aus Verrat, sondern aus Zuneigung. Nicht, um ihn zu verabschieden, sondern um ihn aus dem Griff des Slop-Liberalismus zu befreien.
Alexander Schwitteck ist Mitgründer von ævum und als Fellow / Referent beim Think-Tank Zentrum Liberale Moderne in Berlin tätig.
Gleichzeitig promoviert er an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn am Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Philosophie der Antike.
Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Geschichte und Theorie des Liberalismus und Republikanismus sowie in der Rechts- und Staatsphilosophie Immanuel Kants.