Von Markt und Staat allein?
Als die ersten Pioniere in den 60er und 70er Jahren die Vorläufer des Internets entwickelten, taten sie dies auf bewundernswerte Weise. Dutzende Forscher und Heerscharen von Doktoranden bauten kleine Teile, die sich teils erst Jahre später in das Netzwerk einfügen ließen. In jahrelanger, kleinteiliger Forschungsarbeit wurden die ersten Server und Netzwerke entwickelt und auf dem Weg tausende Probleme kreativ und pragmatisch gelöst. Niemand konnte seine Lösungen anderen aufzwingen; beschlossen war nur das, was von allen freiwillig akzeptiert wurde. Erste Standards für das Internet wurden als Requests for Comments formuliert.
Das ganze Netzwerk sollte transparent und anschlussfähig sein, möglichst offen. Nach diesen Grundsätzen legten auch die Network Working Group, und später ihr internationales Pendant INWG, die Grundsteine für das globale Internet. Die Header Wars – der Konflikt um die Frage, welche Informationen in der Kopfzeile einer E-Mail angezeigt werden – wurden beigelegt, indem dutzende Bastler eigene Mailprogramme bauten, die standardisierte Informationen individuell anzeigten. Maximale Kompatibilität bei der Übertragung wurde so mit größtmöglicher Individualisierung auf Nutzerseite verbunden.
Ich bewundere die Werte, die die ersten Internetpioniere in ihrem Schaffen verkörperten. Sie zeigten Kreativität und Pragmatismus dabei, Probleme zu lösen. Solidarität, Zuverlässigkeit und eine Sorge ums Gemeinwohl in der Weise, wie sie das Netzwerk bauten. Individualität und Selbstentfaltung wurden geschätzt, genauso wie der freie Austausch von Ideen und Meinungen. Gleichzeitig basierte das Netzwerk auf freiwilliger Kooperation, auf echter Zustimmung und Überzeugung statt Zwang.
Marius Drozdzewski
30.10.2025
All das sind liberale Werte. Und doch, welch Überraschung, sie betreffen gar nicht den Markt, unser politisches System oder den Staat.
Stattdessen waren sie die persönlichen Überzeugungen von Menschen wie Steve Crocker, dem Autor des ersten Request for Comments. Liberale Werte wie Selbstentfaltung und freiwilligem Schaffen für die Gemeinschaft leiteten diese Menschen darin, ihr Leben zu führen und außerhalb der Öffentlichkeit mit anderen Menschen umzugehen. Wie viel bewundernswerter wirkt ein solches Leben aus liberaler Perspektive, als ein Leben passiven Konsums, das lediglich auf die kurzfristige Lustbefriedigung ausgerichtet ist.
Paradoxerweise würden Patrick Deneen oder Rod Dreher aber doch gerade Letzteres als liberale Lebensweise beschreiben: allein leben, in einer Wohnung in der Großstadt, Fastfood im Internet bestellen, dabei passiv Serien oder Reality TV schauen oder auf Apps für schnellen Sex swipen.
Folgt man Liberalismus-Kritikern wie Rod Dreher oder sogar offensiven Verteidigern wie Milton Friedman kann, ja darf der Liberale eine solche Wertung gar nicht vornehmen. Nein, er muss in passiver Gleichgültigkeit mit den Schultern zucken. Allerhöchstens darf er selbst private Standards – konservative oder religiöse etwa – besitzen, nach denen er selbst ein solches Leben nicht führen wollte. Explizit liberale Standards aber, nach denen man manche Lebenswege höher schätzen dürfte als andere, sollte es nach verbreiteter Auffassung nicht geben.
Diese Einstellung ist nicht nur falsch, sie ist gefährlich. Sie ist es, die uns Scharen junger Menschen nach rechts und links verlieren lässt. Denn die Verweigerung eines ethischen Angebots, also einer Idee eines guten Lebens, heißt, abwesend zu sein im Wettbewerb um die Zukunft unserer Gesellschaft.
Natürlich haben es Konservative, Sozialisten oder religiöse Führer leichter: Sie können, zumindest ihren eigenen Vorstellungen folgend, auf Zwang setzen, müssen andere nicht überzeugen. Sie können auch davon ausgehen, dass es lediglich einen richtigen Lebensweg gibt. Diese Optionen stehen Liberalen nicht offen, die den Pluralismus von Werten und deren notwendigen Konflikte ebenso erkannt haben, wie sie Zwang verabscheuen.
Fraglos bewundern Liberale den Markt auch deshalb, weil er das gleichzeitige Ausleben von Millionen von Lebensentwürfen ermöglicht, gerade ohne dass irgendeine Instanz sie genehmigen muss. Auch deshalb haben vergangene Generationen von Liberalen sich in ihrem Denken auf den Staat und seine Gewalt beschränkt: Wo muss er eingreifen, wo darf er es auf keinen Fall? In diesen Fragen ist es zweifelsohne wichtig, eine harte Grenze zu ziehen zwischen dem, was aus liberaler Sicht verurteilt werden darf (Mord, Diebstahl, üble Nachrede), und dem, was ausschließlich privaten Standards unterliegt (all das, was zwischen consenting adults geschieht).
Diese Trennung ist essentiell, wenn es um liberales Nachdenken über den Staat geht. Sie sollte Liberale jedoch nicht davon abhalten, eigene Ideen des guten Lebens zu entwickeln, für die sie zwanglos werben. Im Gegenteil, Liberale müssen dringend über diese Fragen nachdenken: Was macht ein Leben lebenswert? Wie stehen wir eigentlich zu gesellschaftlichen Entwicklungen? Zu Ästhetik? Zu Alltagsmoral? Zu Beziehungen? Zu Geschlechterrollen? Zu guter Literatur und wertvollen Geschichten? Zu Städten und Natur? Zu digitalen Entwicklungen und unserem sich rapide änderndem Alltagserleben?
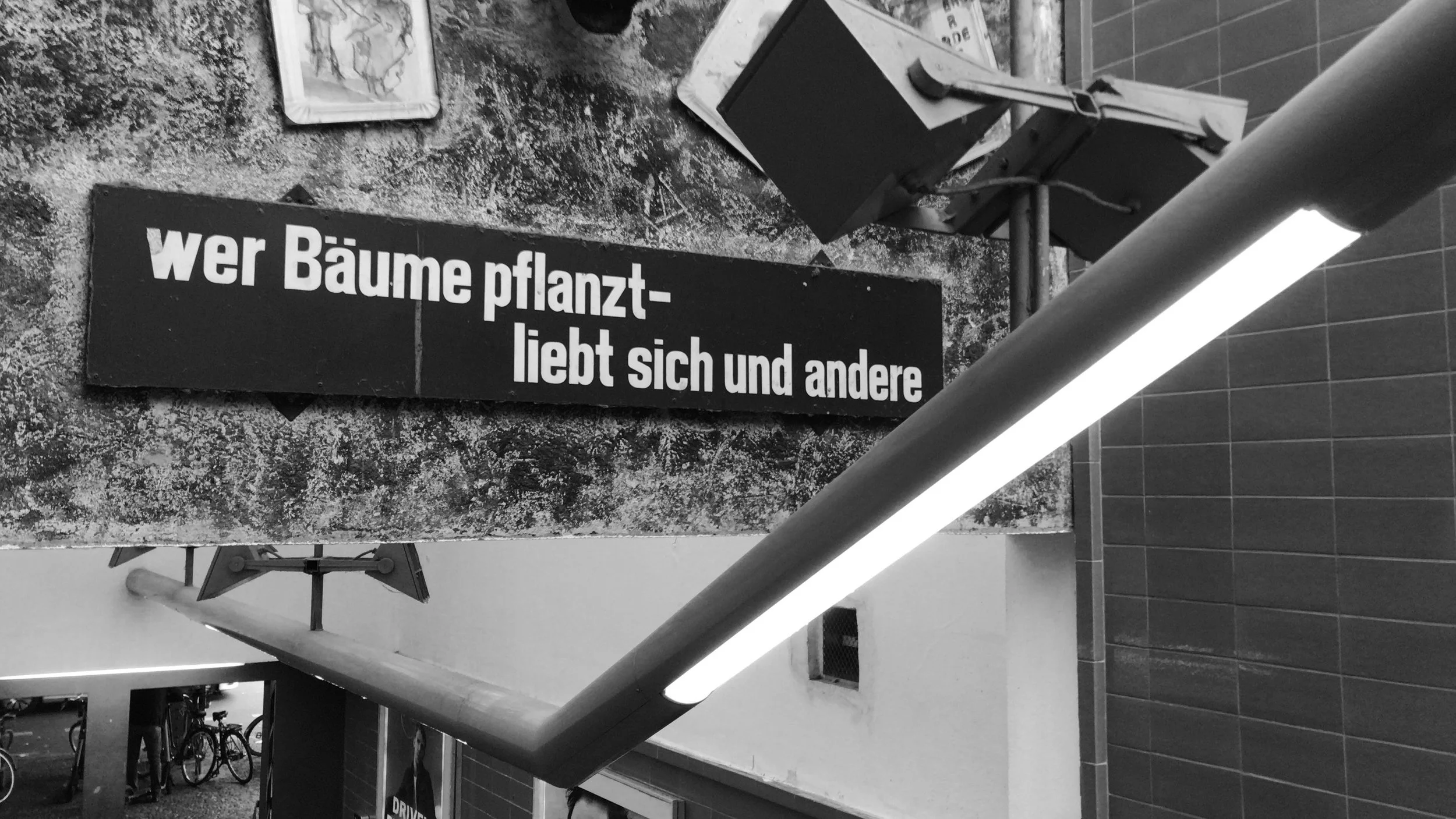
Über Fragen dieser Art denken Linke seit Jahrzehnten öffentlich nach: Skepsis gegenüber Märkten ist auch deshalb so tief im öffentlichen Bewusstsein verankert, weil alle Bücher über gute Beziehungen, das eigene Leben in der digitalen Welt oder den Sinn des Lebens, die sich in einer deutschen Großstadtbuchhandlung finden, aus einem linken Diskurs entspringt, der mit all seinen Grundannahmen durchscheint. Auch Konservative haben dies stets getan und mittlerweile finden selbst Rechte mit ihren Ideen vom guten Leben wieder den Weg in die Öffentlichkeit.
Die Idee eines liberalen Leben als gutes Leben, attraktiv als tugendhaftes Beispiel, wirkt hierzulande dagegen bestenfalls belustigend. Kann man sich Christian Lindner als Beispiel eines guten Lebens vorstellen? Dem öffentlichen Bild folgend, würde man seinen Freunden wohl eher davon abraten, sich ihn zum Vorbild zu nehmen. Andere, die als Liberale in der Öffentlichkeit stehen, geben vielleicht kein ganz so schlechtes Bild ab – aber auch sie stehen eher für ökonomischen Sachverstand oder Rechtspolitik. Wenn Liberale über Vorstellungen vom guten Leben sprechen, dann meist ablehnend oder fast nihilistisch-abfällig. Da sind grüne Vorstellungen von Fleischverzicht und Flugscham ein leichtes Ziel liberaler Aufregung.
Das ist nicht immer so gewesen. Die großen Liberalen vergangener Jahrhunderte, Adam Smith, John Stuart Mill und all die anderen, über die sich Deirdre McCloskey freut, haben moralische Urteile verteidigt, verschiedene liberale Lebensentwürfe beschrieben und sich für liberale Tugenden stark gemacht. Und so gibt es ein Repertoire liberaler Werte, von denen wir ausgehen können: Die eigene Autonomie leben und die eigenen Fähigkeiten nutzen. Anderen dabei helfen, ihre Möglichkeiten zu entfalten. Selbstständige Strukturen aufbauen, bei denen Freiwilligkeit eine Säule ist, aus der Solidarität entspringen kann. Innovation, Kreativität und Ästhetik, die dort entstehen, wo die Grenzen von kleinlich-konventionellen Vorstellungen überwunden werden.
In den letzten Jahrzehnten haben Liberale die Sprache des Guten, Schönen und Wahren, des Moralischen und des Erstrebenswerten verloren. Wir müssen sie wiederentdecken. Wir müssen eigene Lebenswege, Lebensformen, Ideen vom guten Leben entwickeln, denn ansonsten machen es andere. Klar: Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was erzwungen werden darf und dem, wofür wir werben müssen, zwischen einem politischen Liberalismus und einem Liberalismus als Lebensform. Beides ist jedoch nicht unabhängig voneinander. Viele der gleichen Werte wie Autonomie, Innovation, Selbstentfaltung, Kooperation, freiwilliger Solidarität und freiem Austausch, die uns bei der Gestaltung von Recht und Märkten motivieren, leiten auch unser Leben. Und noch mehr liberale Werte ließen sich finden, wenn man erst einmal zu Suchen beginnt.
So sollten Liberale auf die Suche gehen: Welche inspirierenden Beispiele gibt es, die wie Steve Crocker und die ersten Internetpioniere liberale Tugenden lebten? Nur mit neuen Beispielen liberaler Lebensformen ausgestattet, können wir dann unsere Vorstellungen des guten Lebens entwickeln und erfolgreich für sie werben.
Marius Drozdzewski ist Mitgründer von ævum und Head of Strategy & Communication bei Prometheus, einem liberalen Think Tank in Berlin.
Er hat Philosophie und Mathematik studiert und bereitet gerade seine Promotion zur Liberalismuskritik gegenwärtiger Anti-Liberaler vor.


